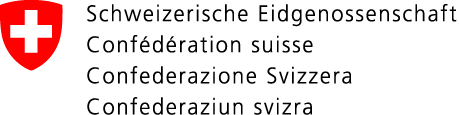Editorial
An einem heissen Sommertag in einem nicht klimatisierten Fahrzeug zu sitzen, kann sich heute kaum mehr jemand vorstellen. Und doch: Vor dreissig Jahren war das im Bahnverkehr die Normalität, als die Flotte der SBB mehrheitlich aus den sogenannten Einheitswagen I und II bestand. Zur Kühlung gab es damals nur eine Möglichkeit: Die Fenster herunterzulassen und den Fahrtwind zu geniessen. Im Winter war es nicht viel besser: Die Wände fühlten sich wegen der schlechten Dämmung kühl an, die Fenster waren undicht, und die Widerstandsheizungen unter den Sitzen wärmten vor allem die Füsse.
Es ist eindeutig: die Fahrzeuge im öV sind behaglicher geworden. Möglich wurde dies durch eine bessere Dämmung sowie durch ausgeklügelte Heizungs-, Kühlungs- und Lüftungssysteme. Die grosse Herausforderung ist heute, die Fahrzeuge jederzeit behaglich zu halten, ohne aber dabei Energie zu verschwenden. Eine einfache Massnahme wäre, im Winter die Raumtemperatur zu senken. Allerdings darf dies nicht dazu führen, dass sich die Fahrgäste weniger behaglich fühlen. Zwei aktuelle Projekte verschiedener Bahnunternehmen und der Hochschule Luzern (HSLU) aus dem Programm ESöV 2050 haben nun gezeigt, dass die Mehrheit der Fahrgäste bei einer Absenkung der Raumtemperatur um bis zu 3 Grad die Fahrzeuge nicht als zu kühl empfindet. Mit einer generellen Absenkung in diesem Ausmass liessen sich bis zu 38 GWh elektrische Energie pro Jahr einsparen, was dem Energieverbrauch von 9'500 typischen Einfamilienhäusern mit vier Personen entspricht. Der Verband öffentlicher Verkehr empfiehlt den Transportunternehmen nun, eine dauerhafte Absenkung der Raumtemperatur zu prüfen.

Kundinnen und Kunden des öffentlichen Verkehrs erwarten zu Recht, dass die Fahrzeuge im Sommer wie im Winter auf einer angenehmen Temperatur gehalten werden. Gleichzeitig ist es ein Gebot der Stunde, Energie zu sparen. Wie eine Grundlagenstudie der HSLU zeigt, gibt es verschiedene Massnahmen, die den Energieverbrauch vermindern ohne die thermische Behaglichkeit zu beeinträchtigen.
Der Energiebedarf für Heizung, Lüftung und Kühlung (HLK) ist beträchtlich. Er kann 20 – 40% des Energieverbrauchs für den Betrieb ausmachen. Das Einsparpotenzial wäre also attraktiv. Das Programm ESöV 2050 unterstützt deshalb seit Beginn Untersuchungen im Bereich HLK, unter anderem die Synthesestudie P- 192, die vor zwei Jahren erschien. Darin hat die HSLU die bis heute bekannten Massnahmen für Energieeinsparungen in Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs dargestellt und ihre Wirkung zu quantifizieren versucht.
In der Folgestudie P-229 hat die HSLU mittels Befragungen bei Fachleuten dieses Inventar erweitert und die Wirkungen der Massnahmen auf die thermische Behaglichkeit und die Energieeffizienz vertieft. Dabei zeigt sich, dass die meisten Energiesparmassnahmen die thermische Behaglichkeit nicht beeinträchtigen. Dazu gehören beispielsweise der Schlummerbetrieb, die Lüftungsregelung mittels CO2-Sensoren, die Verwendung von Wärmepumpen oder eine moderate Temperaturabsenkung im Innenraum. Einige Massnahmen verbessern sogar den Komfort und das Wohlbefinden, namentlich die Dämmung der Fahrzeugwände und die Verwendung hochisolierender Fenster.
Die Studie betrachtete auch die Vorgaben, welche die Industrie und die Betreiber bezüglich der thermischen Behaglichkeit und der Energieeffizienz im Bereich HLK einzuhalten haben. Sie kommt zum Schluss, dass die bestehenden Normen und Richtlinien differenzierte Anforderungen an die thermische Behaglichkeit in den verschiedenen Verkehrsmitteln stellen. Gemäss Aussagen von dazu befragten Fachleuten würden diese auch meistens problemlos eingehalten. Allerdings enthalten die Normen und Richtlinien kaum Vorgaben zur Energieeffizienz. Die Autoren orten entsprechend Nachholbedarf, damit das Energiesparpotenzial bei HLK-Anlagen besser genutzt werden kann. Dies ist besonders bei batteriebetriebenen Fahrzeugen wichtig, welche bei einem geringen Energiebedarf für Heizung, Kühlung und Lüftung von einer grösseren Reichweite profitieren.
Übrigens: Mehr zum etwas sperrigen Begriff «thermische Behaglichkeit» finden Sie im Newsletter vom November 2023.
Wie eine Studie aus dem letzten Winter zeigt, kann mit einer Absenkung der Raumtemperatur um 1 – 3 Grad der Energieverbrauch des Schienen- und Trolleybusverkehrs um bis zu 2% oder 38 GWh pro Jahr reduziert werden. Die Befragung der Fahrgäste im Rahmen einer weiteren Studie verschiedener Transportunternehmen und der HSLU zeigt, dass sich die Zufriedenheit deswegen nicht ändert – sie bleibt weiterhin sehr hoch. Der Verband öffentlicher Verkehr empfiehlt den Unternehmen auf dieser Basis, eine dauerhafte Absenkung der Raumtemperatur zu prüfen.
Im letzten Winter haben die öV-Unternehmen aufgrund der Strommangellage beschlossen, temporär die Innenraumtemperaturen zu senken. Unter der Leitung der SBB und unterstützt von der HSLU beteiligten sich BVB, RBS, SOB, tl, thurbo, BVB und zb an einer Befragung bei ihren Fahrgästen. Diese wollte in Erfahrung bringen, ob die Fahrgäste die Temperatur als zu kalt, zu warm oder angenehm empfanden. Insgesamt wurden an 107 Befragungstagen von Ende Januar 2023 bis Anfang März 2023 rund 29'400 Fahrgäste befragt, dabei wurden rund 13'200 Antworten in Fernverkehrszügen, 14'800 im Regionalverkehr und gut 1'400 im Ortsverkehr gewonnen. Während der Befragung wurde in den Fahrzeugen die tatsächliche Raumlufttemperatur mit Datenloggern erfasst.
Die Ergebnisse zeigen einen Zusammenhang zwischen der Fahrtdauer und der als angenehm empfundenen Temperatur: bei längeren Fahrten (Fernverkehr) liegt sie bei 20 – 22°C, bei Fahrten bis 20 Minuten (Regionalverkehr) bei 18 – 20°C. Bei einer Aufenthaltsdauer der Fahrgäste unter 10 Minuten (Ortsverkehr) ist die Zufriedenheit auch bei 16°C bis 17°C weiterhin hoch. Daraus schliessen die Autoren, dass eine Solltemperatur von 21°C, 19°C bzw. 16°C im Fern-, Regional- bzw. Ortsverkehr möglich ist, ohne dass die Zufriedenheit der Fahrgäste beeinträchtigt wird. Dies entspricht einer Absenkung um 1 – 3°C gegenüber den heute üblichen Sollwerten.
So einfach die Massnahme klingen mag, die Umsetzung hat dennoch ihre Tücken. So benötigt eine dauerhafte Wirkung die Änderung der Temperatur-Sollwertkurve: Bei neueren Fahrzeugen kann diese in der Werkstatt umprogrammiert werden, bei älteren Fahrzeugen muss der Hersteller die Software modifizieren, testen und zulassen. Die Autorinnen und Autoren empfehlen eine Absenkung der Temperatur auf jeden Fall zu prüfen und wo möglich umzusetzen. Dabei sollen nebst der Fahrzeit auch die individuellen Eigenschaften der Fahrzeuge berücksichtigt werden, da beispielsweise die Oberflächentemperatur der Wände und die Luftbewegungen das Temperaturempfinden beeinflussen. Ausserdem raten sie, die Massnahmen mit Befragungen zu begleiten, um bei Bedarf nachjustieren zu können.
Übrigens hat der Vorstand VöV hat an seiner Sitzung vom 8. September den Bericht zur Kenntnis genommen. Er empfiehlt den Transportunternehmen zu prüfen, inwieweit die Temperatur zur Energieeinsparung dauerhaft mittels Änderung der Fahrzeugsoftware abgesenkt werden kann.
Im Projekt P-239 haben die VBZ mit Messungen nachgewiesen, dass ihre Cobra-Trams etwa 14.4 MWh pro Fahrzeug und Jahr einsparen können, wenn die Innenraum-Solltemperatur um 2°C abgesenkt wird. Damit konnten sie bestätigen, dass die rechnerischen Abschätzungen des Einsparpotenzials zutreffen, die eine Temperaturabsenkung mit sich bringt. Nun wollen die VBZ prüfen, ob dies auch für die modernen Flexity-Trams zutrifft.
Dass bei den alten Widerstandsheizungen der Cobras hohe Energieeinsparungen möglich sind, erscheint offensichtlich. Weniger klar ist, ob dies auch bei Trams mit modernerer Technologie zutrifft. Die gut fünfzehn Jahre jüngeren Flexity-Trams verfügen ergänzend zu den Widerstandsheizungen bereits über eine Wärmepumpenheizung und CO2-Sensoren, um den Energiebedarf zu reduzieren.
Im Folgeprojekt P-278 wird nun die Temperatur-Sollwertkurve in den Flexity-Trams unterschiedlich stark abgesenkt. Über die gesamte Winterperiode werden die vom Fahrzeugrechner gesammelten Energiedaten gesammelt und ausgewertet, um die Energieeinsparung gegenüber nicht modifizierten Trams zu bestimmen. Der Versuch wird von Befragungen begleitet, bei denen die Reisenden gebeten werden, ihr Temperaturempfinden anzugeben. Gestützt auf die Ergebnisse der Studie P-273 (siehe Artikel «Weniger heizen im Winter: Was die Passagiere sagen») und die Erfahrungen mit den Cobra-Trams gehen die VBZ davon aus, dass der Fahrgastkomfort durch die moderate Temperaturabsenkung nicht beeinträchtigt wird.
Forum Energie
Am 30. November trifft sich die Branche zum bereits 10. Forum Nachhaltige Energie im Alten Spital Solothurn. Am Vormittag werden Best Practices in der Welt des öffentlichen Verkehrs vorgestellt, am Nachmittag finden Vertiefungsworkshops zu den Themen Photovoltaik, emissionsarme Baustellen, thermische Behaglichkeit und Lithium-Ionen-Batterien statt.
Neuer Programmleiter ESöV 2050
Wir freuen uns, ihnen den neuen Programmleiter ESöV 2050 vorstellen zu können: Stany Rochat. Er ist zurzeit Leiter des Büros der Enotrac in Lausanne. Mit seiner Ausbildung als Elektroingenieur und seinen Kenntnissen im Bereich Schienenverkehr bringt er beste Voraussetzungen für die Leitung des ESöV 2050 Programmes mit. Herr Rochat wird voraussichtlich seine neue Tätigkeit beim BAV am 3. Januar 2024 aufnehmen.
Juli
Editorial
In den zehn Jahren seines Bestehens hat das Programm ESöV 2050 zahlreiche technische Lösungen zur Verminderung des Energieverbrauchs im öffentlichen Verkehr untersucht, und noch immer gibt es neue Fragen zu beantworten. Ein Beispiel dafür ist die Bedeutung der Kondensation in Zugwänden. Der Hochschule Luzern (HSLU) ist es nun gelungen, mittels Simulationen den Einfluss von Wärmebrücken in diesem komplexen Thema zu klären. Um energieeffizient und klimaschonend mobil zu sein, braucht es aber nicht nur technische Lösungen im öV, sondern eine Optimierung des Gesamtsystems. Auch hier liegen aufschlussreiche Forschungsergebnisse vor, und zwar zur Bündelung von Mobilitätsangeboten in einem individuellen «Sorglospaket» und zur Gestaltung einer klimaschonenden Mobilität im alpinen Raum. Der Logik der Systembetrachtung folgend enthält dieser Newsletter ausserdem einen Gastbeitrag aus dem Programm «Bahninfrastrukturforschung», der Ansätze zur Kreislaufwirtschaft bei Gleisaushub beleuchtet.
 postauto ag.jpg)
Der Umstieg vom fossil betriebenen Auto auf öV, Elektroauto, Fahrrad und Fussverkehr spielt eine wichtige Rolle, um den Energieverbrauch und die Klimawirkung des Verkehrs zu vermindern. Die Hürden dazu sind aber hoch, wie das kürzlich abgeschlossene Projekt «Sorglos mobil» zeigt, denn Mobilitätsgewohnheiten zu durchbrechen ist nicht einfach.
Wenn es gelänge, Mobilitätsangebote einfach zugänglich zu machen und auf einer Plattform zu bündeln, müsste es doch eigentlich möglich sein, Kundinnen und Kunden für eine umweltfreundlichere Mobilität zu gewinnen. Mit dieser Idee im Kopf entwickelte PostAuto gemeinsam mit Zug Estates, Mobility und der Mobilitätsakademie im Rahmen des ESöV-Projektes P-165 das Produkt «Sorglos mobil», eine innovative und ganzheitliche «Mobility-as-a Service» (MaaS)-Lösung für Wohnareale. Die ökologische Vorzeigesiedlung «Suurstoffi» in Risch ZG diente als Reallabor, um das Angebot im überschaubaren Rahmen zu testen.
Im zwei Jahre dauernden Projekt konnten die rund 500 Haushalte der Siedlung ein Mobilitätsbundle erwerben. Damit hatten sie Zugriff auf 2 Elektroautos und 6 Leihvelos (E-Bikes und Lastenvelos) vor der Haustür, vergünstigte Tarife im öV und bei Publibike sowie Zugang zur Flotte von Mobility. In der ersten Projektphase wurde das Bundle zum Fixpreis angeboten, in der zweiten als «pay per use»-Modell. 16 Personen nutzten das Angebot und legten insgesamt 6701 Kilometer mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln zurück. Sie verbrauchten damit 3.5-mal weniger Energie und erzeugten 7-mal weniger CO2-Emissionen als die durchschnittliche Bewohnerschaft des Areals. Die positive Umweltwirkung konnte also klar bestätigt werden.
Der Zuspruch für das Angebot lag unter den Erwartungen. Teilweise lässt sich dies mit der Pandemie erklären, während der der öV und die geteilte Mobilität einen schweren Stand hatten. Ein ebenso wichtiger Grund dürfte aber im gewohnten Mobilitätsverhalten zu suchen sein. 84% der Bewohnerinnen und Bewohner der Siedlung besitzen ein eigenes Auto. Fast die Hälfte aller befragten Personen sehen keinen Grund oder keine Möglichkeit, ihre Autonutzung zu reduzieren. Entsprechend bewerteten sie das Angebot von Sorglos mobil auch als nicht bedürfnisgerecht. Das Interesse für die geteilte Mobilität vor der Haustüre (E-Autos, E-Bikes und Cargovelos) konnte bei Autobesitzerinnen und -besitzern auf dem Suurstoffi-Areal dennoch geweckt werden. Die Anwohnerinnen und Anwohner haben diese Angebote aber vor allem individuell genutzt und waren zurückhaltend beim Abschliessen von Abonnementen.
Insgesamt zeigt das Projekt, dass eine Bündelung von Mobilitätsangeboten bei Zielgruppen, die nicht ausschliesslich oder mehrheitlich mit dem Auto unterwegs sind, gut aufgenommen wird. Ein niederschwelliger Zugang und der Fokus auf die Freizeit senken die Hemmschwelle, sich auf das Angebot einzulassen. Wichtig wäre es auch, ein einfaches Komplettangebot via App zur Verfügung zu stellen, welches Suche, Buchung und Bezahlung kombiniert. Die Projektleitung kommt zum Schluss, dass dies erst möglich ist, wenn Datenaustausch-Standards bestehen, die die Datensicherheit gewährleisten und die Zusammenarbeit zwischen Mobilitätsakteuren erleichtern.
Bergregionen sind vom Klimawandel besonders betroffen, haben aber auch ein grosses Potenzial, mit eigener Energie aus erneuerbaren Quellen ihre Mobilität klimaschonend zu gestalten. Am Beispiel der Walliser Region Adret zeigt eine Studie, wie der Umstieg gelingen kann.
Die Region Adret reicht von St. Léonard im Rhonetal über zahlreiche Dörfer und Weiler auf sonnigen Terrassen über das Skigebiet von Anzère bis hinauf zum Wildhorn (3248 m). Dass sich hier andere verkehrstechnische Herausforderungen stellen als in einer Agglomeration des Mittellands, ist offensichtlich. Der Ansatz, den das dort beheimatete Centre de Développement Durable des Alpes zusammen mit der Fachhochschule Westschweiz HES-SO Valais-Wallis und der Firma Transportplan vorschlägt, lässt sich aber durchaus übertragen.
Ausgangspunkt ist die aktuelle Klimabilanz der Region, die zeigt, dass im Bereich der Mobilität 95 % der CO2-Emissionen und des Energieverbrauchs durch Privatfahrzeuge verursacht werden. Entsprechend setzt die Studie den Schwerpunkt bei den Haushalten, um eine klimaschonende, energieeffiziente Mobilität zu erreichen. Dazu wird ein Vorgehen in drei Etappen skizziert.
Kurzfristig soll bei der Bevölkerung eine Sensibilisierung erreicht werden. Um dies zu unterstützen hat das Projekt eine Broschüre, eine Website und eine Online-Entscheidungshilfe entwickelt. Mittelfristig (bis 2030) soll der Motorisierungsgrad eines Teils der Haushalte gesenkt werden, indem sie auf das Zweitauto verzichten und Alternativen zum Privatfahrzeug (Carsharing, Rufbusse, Ausbau Langsamverkehr, Coworking etc.) gefördert werden. Bis 2040 schliesslich soll der Verkehr gar keine Emissionen mehr erzeugen. Dafür sollen die Haushalte vollständig auf Elektrofahrzeuge umsteigen und den dafür erforderlichen Strom zumindest teilweise in eigenen Photovoltaikanlagen erzeugen. Der öffentliche Verkehr soll elektrisch oder mit Hybridantrieb erfolgen. Zur Deckung des zusätzlichen Strombedarfs für die Mobilität soll vor Ort mehr erneuerbare Energie erzeugt werden, beispielsweise mit einer schwimmenden Solaranlage auf dem Stausee «Lac de Tzeusier».
Wie bei Gebäuden spielen Wärmebrücken auch bei Fahrzeugen eine wichtige Rolle: sie reduzieren die Wirkung der Dämmung und können die Behaglichkeit im Innenraum schmälern. Ausserdem kann sich an Wärmebrücken Feuchtigkeit absetzen, welche zu Schimmelbildung und Korrosion der Fahrzeugwände führen kann. Simulationen zeigen nun: eine wesentliche Beeinträchtigung der thermischen Behaglichkeit ist deswegen aber nicht zu erwarten.
Die Wände von Fahrzeugen werden gedämmt, um den Energieverlust zu minimieren und kalte Oberflächen im Fahrgastraum zu verhindern. Sammelt sich im oder auf dem Isolationsmaterial kondensierende Feuchtigkeit an, wird die Dämmwirkung herabgesetzt. Die 2019 publizierte Studie «Berechnung der Kondensation in Zugwänden» (P-122) hat mittels Simulationen gezeigt, dass in flächigen Dämmungen der Feuchtegehalt bei grossen Temperaturdifferenzen zwischen Innenraum und Umgebung zwar ansteigen kann, aber nicht in dem Mass, dass mit Wasseransammlung zu rechnen ist. Die Dämmwirkung wird somit nicht beeinträchtigt.
Nicht beantwortet wurde in der Studie aber die Frage, ob auch bei Wärmebrücken Entwarnung gegeben werden kann. Ein typisches Beispiel für Wärmebrücken in Eisenbahnwagen sind die Cantilever-Aufhängungen der Sitze, die an der Fahrzeugwand befestigt sind. Da dort die Dämmung durchbrochen wird, besteht eine erhöhte Gefahr von Kondensation. Ist diese ausgeprägt genug, bilden sich lokal Wassertropfen, was zu Schimmelbildung und Korrosion der Fahrzeugwand führen kann.
Diese Lücke hat das Team der HSLU, Abteilung Technik und Architektur, mit ihrer vom BAV finanzierten Folgestudie «Kondensation im Zusammenhang mit Wärmebrücken in Zugwänden» geschlossen. Ihre Simulationen zeigen, dass tatsächlich an Ecken und Kanten von Wärmebrücken die Kondensation erhöht ist. Sind Befestigungen ohne zusätzliche Dämmplatte auf die Aussenwand geschraubt (also nicht überdämmt), und ausserdem einer konvektiven Luftströmung ausgesetzt, können sich innerhalb einiger Stunden Wassertropfen bilden, die unter Einfluss der Schwerkraft abfliessen. Auch bei einem Kontakt zwischen Wärmebrücke und Dämmmaterial kann der Feuchtegehalt in der Dämmung stark ansteigen, sodass daraus abfliessendes Wasser zu erwarten ist.
Die Behaglichkeit im Innenraum und die Energiebilanz des Fahrzeugs werden durch die Wärmebrücken nicht beeinträchtigt, dafür ist ihr Flächenanteil in der Regel zu gering. Zur Vermeidung von Korrosion empfehlen die Autoren aber dennoch, Wärmebrücken zu überdämmen oder, wo dies nicht möglich ist, die konvektive Anströmung zu verhindern und mit einem Luftspalt grössere Ansammlungen von Kondenswasser im Dämmmaterial zu vermeiden.
Jedes Jahr fallen in der Schweiz schätzungsweise 0.5 – 0.7 Mio. Tonnen Gleisaushub an. Dieses Material ist eigentlich zu wertvoll, um deponiert zu werden. Vielmehr sollte es im Sinn der Kreislaufwirtschaft aufbereitet und wieder im Gleisbau eingesetzt werden, um die natürlichen Ressourcen von Hartgesteinsschotter zu schonen. Wie lässt sich dieses Ziel erreichen?
Der sachgerechte Umgang mit Gleisaushub ist in der gleichnamigen Richtlinie festgelegt. Allerdings zeigt sich anhand der Erfahrungen in der Praxis, dass Revisionsbedarf besteht. Einerseits ist der Begriff «Gleisaushub» abfallrechtlich nicht klar definiert. Entsprechend besteht Interpretationsspielraum bei der Klassierung des Materials und den sich daraus ergebenden Entsorgungswegen. Andererseits ist die stoffliche Verwertung bisher nicht verbindlich geregelt. Zwar wird eine erhebliche Menge als Kies- und Sandgemische in der Bauwirtschaft genutzt. Anzustreben wäre aber statt dieses Downcyclings eine Wiederverwendung als Schotter, um die schwindenden Bestände an Hartschotter in den inländischen Steinbrüchen zu schonen.
Die Revisionsarbeiten bedürfen einer soliden inhaltlichen Grundlage. Deshalb hat das BAV über das Programm Bahninfrastrukturforschung die Studie «Verwertungspflicht des Gleisaushubs: Behandlungsverfahren und Verwertungpotenzial» inkl. «Teil B: Ökobilanz, Kosten und Öko-Effizienz» in Auftrag gegeben. Damit soll es möglich werden, den Begriff «Gleisaushub» abfallrechtlich sauber zu definieren und dann in der massgebenden Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (VVEA) zu verankern. Die Studie soll auch zukünftige Verwertungswege aufzeigen, die dem Gedanken der Kreislaufwirtschaft entsprechen. Das BAV plant, dazu im Herbst ein Merkblatt zu veröffentlichen.
Energiekennzahlen öV
Wie viel Energie wird im öV verbraucht? Welche Anteile haben die verschiedenen Energieträger? Und wie sieht die Klimabilanz der einzelnen Verkehrsmittel aus? Die 2020 erstmals erhobenen Energiekennzahlen geben Auskunft.
Aktivitätenbericht
Die Berichterstattung zum Programm ESöV 2050 erfolgt neu im Rahmen der Publikation «Forschung und Innovation im öffentlichen Verkehr». Die Publikation im attraktiven Magazinformat präsentiert eine Auswahl der im letzten Jahr unterstützten Projekte im Programm ESöV 2050, im Programm «Bahninfrastrukturforschung» und «Innovation im regionalen Personenverkehr». Sie finden die aktuelle Ausgabe hier. Die Ausgaben der Berichtsjahre 2013 – 2021 sind im Archiv weiterhin einsehbar.
Februar
Editorial
Wasserstoff hat im vergangenen Jahr viel Aufmerksamkeit erfahren. Aber was taugt er wirklich – im Kontext des öffentlichen Verkehrs? Inwiefern eignet sich Wasserstoff – in Brennstoffzellenbussen, Wasserstoff-Verbrennungsmotoren und Stromgeneratoren – als Ersatz für Diesel und Co? Dieser Newsletter versammelt alle vom Programm ESöV 2050 geförderten Wasserstoffprojekte, und er zeigt: Wasserstoff als Ersatz für fossil betriebene Systeme macht aus Sicht Effizienz und Kosten nur dort Sinn, wo Batterien nicht die geforderte Energiemenge bereitstellen können.
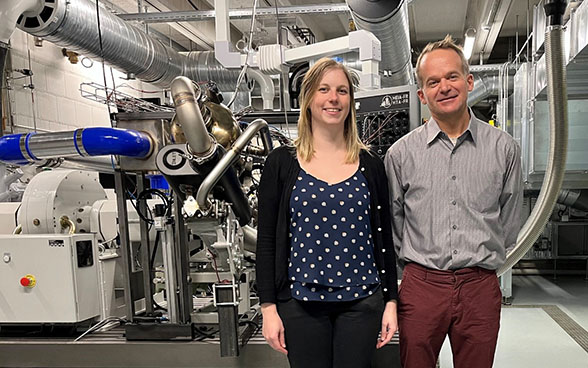 BAV.jpg)
Im öV-Netz der Schweiz verkehren derzeit rund 6000 Dieselbusse. Aufgrund der gesetzten Klima- und Energieziele sollen diese Busse durch CO2-neutrale Alternativen ersetzt werden, konkret durch Batterie- und Wasserstoffbusse. Eine vom BAV initiierte Auftragsstudie, die beide Lösungen unter die Lupe nimmt, kommt zum Schluss, dass Wasserstoffbusse nur auf Überlandstrecken sinnvoll sind.
Die vom BAV in Auftrag gegebene Studie (P-199) zeigt überraschend, dass Batteriebusse, sobald die Mineralölsteuer-Rückerstattung wegfällt, über den gesamten Lebenszyklus betrachtet günstiger sein werden als Dieselbusse. Grund dafür ist insbesondere, dass Batteriebusse weniger aufwändig gewartet werden müssen und viel weniger Energie benötigen. Die Mineralölsteuer-Rückerstattung ist voraussichtlich ab 2026 hinfällig – so bestimmt es das revidierte CO2-Gesetz, für welches der Bundesrat im Herbst 2022 die Botschaft an das Parlament verabschiedet hat.
Anders sieht es bei den Wasserstoffbussen (Brennstoffzellenbusse und Busse mit Wasserstoff-Verbrennungsmotor) aus. Brennstoffzellenbusse sind noch nicht wirtschaftlich betreibbar, allerdings könnten sie es werden, wenn in einigen Jahren die Beschaffungspreise infolge grösserer Produktionszahlen deutlich sinken. Busse mit Wasserstoff-Verbrennungsmotor sind am Markt aktuell noch gar nicht erhältlich, könnten aber mittelfristig vergleichsweise günstig hergestellt werden und die Brennstoffzellenbusse punkto Wirtschaftlichkeit überholen (vgl. hierzu auf den Beitrag «Der Wasserstoff-Verbrennungsmotor auf dem Prüfstand» im vorliegenden Newsletter).
Auch wenn noch unklar ist, wann genau Wasserstoffbusse wirtschaftlich betrieben werden können, zeichnet sich ab, dass sie im Regionalverkehr, wo längere und gerade in der Schweiz topografisch anspruchsvollere Strecken zu überwinden sind, für die Erreichung der Klimaziele eine wichtige Rolle spielen dürften. Hingegen macht es nicht Sinn, Wasserstoffbusse im Stadtverkehr einzusetzen, dort genügen die deutlich effizienteren Batteriebusse den Anforderungen.
Es ist anspruchsvoll, aber möglich, die 6000 Diesel-Busse, die im öV unterwegs sind, durch Batterie- und Wasserstoffbusse zu ersetzen und den entsprechenden Strom CO2-neutral zur Verfügung zu stellen. Mitunter können dabei auch Photovoltaikanlagen auf den Flächen der Transportunternehmen eine Rolle spielen (bez. Fördermöglichkeiten vgl. die Informationen am Ende dieses Newsletters).
Die Vielseitigkeit des grünen Wasserstoffs macht ihn zum idealen Kandidaten für die Dekarbonisierung aller energieintensiven Transportsysteme. Der Schwachpunkt ist die Produktion: Die Reaktion der Wasserelektrolyse muss unter stabilen Bedingungen ablaufen, weshalb Solar- und Windenergie nur sehr bedingt für die Herstellung von Wasserstoff geeignet sind. Um die Schwankungen der Sonneneinstrahlung auszugleichen, kombinieren Hersteller von grünem Wasserstoff die Photovoltaik mit Wasserkraft, insbesondere mit Speicherkraftwerken.
Wie kommen Busse im Regionalverkehr weg vom Diesel? Die Freiburgische Verkehrsbetriebe (TPF) und die Hochschule für Technik und Architektur Freiburg (HTA-FR) untersuchen Lösungen für Einsatzbereiche, die von Elektrobussen kaum abgedeckt werden können und stellen dabei den Wasserstoff-Verbrennungsmotor in den Fokus.
Das Transportunternehmen TPF betreibt zwar die Buslinien in den Städten Freiburg und Bulle; aber die Mehrheit der Busse ist im Regionalverkehr unterwegs. Viele dieser Busse sind Gelenkbusse, und sie sind den ganzen Tag und oft auf topografisch anspruchsvollen Strecken unterwegs. Dabei legen sie 300 bis 350 Kilometer zurück. Noch gibt es keine Elektrobusse, die eine solche Distanz ohne – im ländlichen Raum besonders kostenintensive – Zwischenladung schaffen.
Für den ländlichen Raum können wasserstoffbasierte Lösungen, trotz ihrer geringeren Energieeffizienz im Vergleich zu Elektrobussen, eine interessante Alternative sein. Bereits seit einigen Jahren am Markt erhältlich sind Brennstoffzellenbusse. Noch weniger weit entwickelt sind Busse mit Wasserstoff-Verbrennungsmotor. In zwei vom BAV mitfinanzierten Studien (P-155 und P-255) untersucht TPF mit Unterstützung der HTA-FR und Fiat Powertrain Technologies die technische und wirtschaftliche Machbarkeit des Einsatzes solcher Busse. Die bereits abgeschlossene Studie P-155 zeigt: Die technische Machbarkeit von Bussen mit Wasserstoff-Verbrennungsmotor ist grundsätzlich gegeben, und im ausserstädtischen Bereich sind sie auch preislich konkurrenzfähig.
Dies in doppelter Hinsicht: Erstens gegenüber Elektrobussen, weil deren Betrieb im Regionalverkehr schwieriger und teurer ist. Und zweitens gegenüber Brennstoffzellenbussen, weil ein Bus mit Wasserstoff-Verbrennungsmotor bei grösserer Geschwindigkeit oder stärkerer Steigung effizienter unterwegs sein kann als das «technische Halbgeschwister».
Der Wasserstoff-Verbrennungsmotor hat auch einen Nachteil: Bei der Verbrennung von Wasserstoff entstehen – wie übrigens auch bei der Verbrennung fossiler Treibstoffe – Stickoxide. Projekt P-255 beschäftigt sich deshalb nicht zuletzt mit der Frage, wie es gelingen kann, die Emissionen von Stickoxiden nahe Null zu senken.
Bei TPF sind aktuell alle vier Dieselalternativen im Gespräch: Batterie- und Trolleybusse für den städtischen Einsatz, Brennstoffzellenbusse und Busse mit Wasserstoff-Verbrennungsmotor für den Regionalverkehr. Voraussichtlich bereits 2024 werden im Rahmen eines Pilotprojekts zwei oder drei Brennstoffzellenbusse in Betrieb gehen. Der benötigte grüne Wasserstoff soll lokal in der Wasserkraftanlage Schiffenen hergestellt werden. Aus Effizienzsicht besonders interessant sind übrigens Busse mit grosser Batterie und kleiner Brennstoffzelle: Solche Busse sind dann mehrheitlich mit der effizienteren Batterieenergie unterwegs, während die Brennstoffzelle nur dazu da ist, die tägliche Reichweite um die fehlenden ca. 150 km zu steigern.
In einer vom BAV finanzierten Studie untersucht die SBB den möglichen Einsatz von Wasserstoff auf Bahnbaustellen. Dabei zeigt sich, dass Wasserstoff primär für die Energieversorgung von Baustellen mit Stromgeneratoren eine valable Alternative darstellt. Die Leistungsanforderungen von Baudienstfahrzeugen und tragbaren Kleingeräten hingegen können günstiger und effizienter mit Batterielösungen abgedeckt werden.
Gleisbauarbeiten finden meistens nachts statt, bei ausgeschalteten oder nicht vorhandenen Fahrleitungen, oft fernab des öffentlichen Stromnetzes. Die verwendeten Fahrzeuge, Maschinen, Bürocontainer, Baustellenbeleuchtungen etc. müssen deshalb energieautark funktionieren, zumindest während der Dauer einer Nachtschicht.
Bisher werden Baustellen vor allem dieselbasiert betrieben. Geht es nach der Klimastrategie der SBB, soll damit aber spätestens 2030 Schluss sein. Vor diesem Hintergrund untersucht das Unternehmen, wo Wasserstoff durch Diesel ersetzt werden kann – und wo nicht (Projekt P-214). Unter die Lupe genommen werden drei Teilbereiche: Baudienstfahrzeuge, Stromgeneratoren und tragbare Kleingeräte.
Was die Baudienstfahrzeuge betrifft, so zeigt sich, dass die Anforderungen mit Batterien erfüllt werden können, wenn auch eher knapp: Die Fahrzeuge sind (ohnehin) schon schwer und müssen während Stunden noch viel Energie zur Verfügung stellen, mit den zusätzlichen Batterietonnen kommen sie an die Gewichtsgrenze. Ein wichtiger Vorteil ist, dass sie via Stromabnehmer und Fahrleitung auf der Hin- und Rückfahrt und in der Niederlassung innert kürzester Zeit ihre Batterien laden können. Im Vergleich zu Batterien ist Wasserstoff wesentlich weniger effizient – im untersuchten Fall würde mindestens die doppelte Energiemenge benötigt – und es müsste eine schwer amortisierbare Tankinfrastruktur aufgebaut werden.
Ähnlich ist es bei den tragbaren Kleingeräten. Batteriebetriebene Systeme genügen den Anforderungen in der Praxis. Es gibt deshalb keinen Grund, auf Wasserstoff auszuweichen. Bei grossen Gleisbauzügen mit extrem hohem Energiebedarf unter ausgeschalteter Fahrleitung könnte die Situation anders aussehen. Diese Fahrzeuge werden aber von Drittfirmen betrieben und sind nicht Teil der Studie.
Bleibt die Energieversorgung von Baustellen mit Stromgeneratoren: Für diese wird weiterhin Wasserstoff in Betracht gezogen. Die SBB unterziehen deshalb in diesem Jahr einen mobilen wasserstoffbetriebenen Generator einem Praxistest.
Eine Herausforderung, mit der sich die Studie ebenfalls beschäftigt, sind Sicherheitsaspekte. Wasserstoff ist leicht und damit flüchtig, bei Ansammlung in (teilweise) geschlossenen Räumen gleichzeitig extrem zündfähig. Ob und unter welchen Voraussetzungen Wasserstoff dereinst in Tunnels zum Einsatz kommen kann, ist gemäss heutigem Stand nicht geklärt. Die SBB untersucht die Frage in Zusammenarbeit mit dem Gas- und Wasserverband (SVGW), dem TÜV und der SUVA. Weil die Frage die ganze Gasbranche betrifft, ist das Ziel, bestenfalls ein Regelwerk zu erstellen, das definiert, unter welchen Voraussetzungen Wasserstoff in (teilweise) geschlossenen Räumen verwendet werden darf.
Laura Amaudruz ist Leiterin der Abteilung Innovation und Netzwerkentwicklung bei Transports publics fribourgeois Trafic (TPF TRAFIC) SA. Sie leitet die im Newsletter erwähnten Projekte 155 und 255 seitens TPF. Der ESöV-Newsletter hat die Bauingenieurin zum Interview getroffen.
Welche Rolle spielen regionale Partner bei der Wasserstoffstrategie des Unternehmens, von der Hochschule für Technik und Architektur Freiburg (HTA-FR) mal abgesehen?
Es gibt im Kanton gleich zwei zukünftige Anbieter für die Herstellung von grünem Wasserstoff, Groupe e und Gruyère Énergie SA. Ausserdem sind wir im Gespräch mit Schwerlast-Transportunternehmen, welche Brennstoffzellenlastwagen beschaffen möchten. Und weiter gibt es im Kanton einen Hersteller von Baumaschinen, der wie wir am Wasserstoff-Verbrennungsmotor forscht.
Das Gute ist ja, egal, welche Wasserstofftechnik zum Einsatz kommt, getankt wird in jedem Fall mit Wasserstoff. Tankinfrastrukturen können also prinzipiell gemeinsam betrieben und genutzt werden, was wirtschaftlich interessant ist.
Batteriebetriebene Busse sind energieeffizienter als die Wasserstoffalternativen. Und die Reichweite der Batterien steigt von Jahr zu Jahr. Wann werden Batteriebusse sämtliche Bedürfnisse abdecken können?
Das ist in der Tat eine grosse Unbekannte. Wenn wir zurückblicken, zeigt sich, dass die Reichweite von Gelenk-Bussen im topografisch anspruchsvollen Gelände in den vergangenen 5 Jahren um ca. 30 bis 50 Kilometer zugenommen hat. Wir sind jetzt bei ca. 200 km ohne Zwischenladung. Wir benötigen aber mindestens 300 bis 350 km.
Zeigen die Freiburger Bevölkerung oder die Fahrgäste von TPF ein besonderes Interesse an der Dekarbonisierung des Verkehrs oder speziell an Wasserstoff?
Wir beobachten ein besonderes Interesse seitens der Anwohnenden von Buslinien. Weil Elektrobusse auch leiser sind, kann die Lärmbelastung am Wohnort dieser Menschen spürbar reduziert werden.
Generell ist unser Eindruck, dass sich die Fahrgäste ganz allgemein für die Dekarbonisierung interessieren, und dass es ihnen einerlei ist, mit welchen technischen Lösungen diese erreicht wird. Explizit für Wasserstoff interessieren sich primär Menschen, die selbst beruflich mit Wasserstoff zu tun haben.
Im öV-Bereich gibt es viele Flächen, die für die Solarstrom-Produktion hervorragend geeignet sind, aber bis anhin meistens brachliegen: Dächer und/oder Fassaden von Bürogebäuden, Perrons und Wartungsgebäuden beispielsweise. So weit, so erwartbar. Nicht gleichermassen erwartbar dürfte für viele Transportunternehmen (TU) hingegen die Tatsache sein, dass Photovoltaik-Anlagen auf solchen Flächen via Bahninfrastrukturfond (BIF) und Abgeltungen im regionalen Personenverkehr (RPV) finanziert werden können. Ein Beitrag im BAV-News-Blog gibt einen Überblick über sämtliche Förderinstrumente, die den TU zur Verfügung stehen.