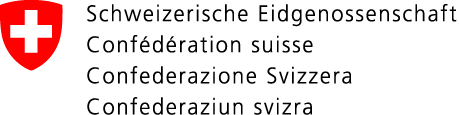Editorial
Der Winter kommt und mit ihm die letzte Ausgabe unseres Newsletters im 2024. In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen weitere aktuelle Projekte vor. Mehrere davon betreffen die Dekarbonisierung unseres Strassenverkehrs: die Elektrifizierung einer alpinen Buslinie, Synergien zwischen einem Tramnetz und dem Aufladen von E-Bussen sowie ein frei zugängliches Simulationstool.
Bei den Strassenbahnen geht es um die Messung der Wirksamkeit von Schutzfolien, die auf den Scheiben angebracht werden, um die Sonneneinstrahlung zu begrenzen. Im Eisenbahnbereich schliesslich liefern wir Ihnen die Ergebnisse eines Projekts, das in unserer Ausgabe vom Mai 2020 vorgestellt und deren Langzeitmessungen inzwischen abgeschlossen wurden. Es ermöglicht den Appenzeller Bahnen, einen Teil der Bremsenergie in das 50 Hz-Netz zurückzuspeisen.
Viel Spass beim Lesen und einen schönen Winter!

© SchweizMobil
Die Buslinie von Fideris auf die Bündner Heuberge soll auf Elektroantrieb umgestellt werden. Distanz und Steigung der Fahrstrecke sowie enge Kurven und Schnee im Winter erhöhen die Anforderungen an Elektrobusse im Berggebiet.
Gut 1000 Höhenmeter in 20 Minuten überwindet der Passagierbus von Fideris auf die Heuberge. Auf einer solchen Bergstrecke stellt die geplante Umstellung der zwölf Diesel-Fahrzeuge auf Elektroantrieb zusätzliche Anforderungen. So erhöht die Steigung den Energiebedarf und im Winter verringern schneebedeckte Strassen die Energierückgewinnung bei Talfahrten. Zudem erfordern die engen Kurven Fahrzeuge mit Allradantrieb. Auf dem Markt sind bisher keine Fahrzeuge verfügbar, die unter diesen Bedingungen eingesetzt werden könnten und zugleich die notwendigen Batteriekapazitäten haben. Der Kontakt zu möglichen Herstellern ist aber etabliert.
Auch die Versorgung mit erneuerbarer Energie ist noch zu klären. Im Sommer könnte der Bedarf mit Photovoltaik-Anlagen gedeckt werden, im Winter müsste jedoch mit Wind- oder Wasserkraft ergänzt werden. Geprüft werden dafür freistehende Kleinwindanlagen. In einem Vorprojekt wollen die Verantwortlichen bis im Frühjahr 2025 die Herausforderungen für die Elektrifizierung von Bussen in Berggebieten am Beispiel des Skigebietes Heuberge AG detailliert untersuchen und passende Lösungsmodelle entwickeln.
Die Umstellung auf Elektrobusse ist bei praktisch allen öffentlichen Verkehrsbetrieben ein Thema. Aber welche Strategie ist die Richtige? An der Fachhochschule Südschweiz in Mendrisio wird ein bestehendes Online-Tool erweitert, um insbesondere kleine und mittlere Verkehrsbetriebe strategisch zu unterstützen.
Unter dem Titel «PVxTE» ist seit Frühjahr 2024 ein Webtool verfügbar, das Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs dabei unterstützt, abzuschätzen, ob eine bestehende Buslinie mit einem Elektrobus betrieben werden kann. In einem Nachfolgeprojekt wird die Fachhochschule Südschweiz (SUPSI) das Tool erweitern und verbessern. Ziele sind eine genauere Abschätzung des Energiebedarfs, eine ausführlichere Darstellung der Ergebnisse und mehr Benutzerfreundlichkeit. Für die Kalibrierung der Berechnungsmodelle werden gemessene Verbrauchsdaten von Elektrobussen in der Deutsch- und Westschweiz verwendet.
«Wir wollen eine benutzerfreundliche und frei zugängliche Webanwendung bereitstellen, mit der die Machbarkeit der Elektrifizierung von Buslinien vorab geprüft werden kann», sagt SUPSI-Projektleiter Davide Strepparava. Das Angebot soll auch dazu beitragen, die Abhängigkeit von teuren externen Studien zu verringern.
Die Basler Verkehrs-Betriebe stellen ihre Busflotte bis Mitte 2027 auf batterieelektrische Fahrzeuge um. Aufgeladen werden sie in Zukunft im Depot. Zur Erhöhung der Verfügbarkeit wird ergänzend die Möglichkeit vorgesehen, die Fahrzeuge über eine Tram-Oberleitung zu laden.
Bei der Umstellung der Busflotte auf batteriebetriebene Fahrzeuge gehen die Basler Verkehrs-Betriebe davon aus, dass das Aufladen im Depot für den Alltagsbetrieb genügt. Zur Sicherheit ist jedoch vorgesehen, ergänzend eine Ladestation in Betrieb zu nehmen, damit die Busse bei Bedarf auch über eine Tram-Oberleitung geladen werden können. Dies zum Beispiel für den Fall, dass das öffentliche 50-Hertz-Versorgungsnetz im Depot ausfällt.
Mit der Gleichstrom-Anlage wird auch geprüft, ob die elektrische Energie, die beim Bremsen eines Trams erzeugt wird, besser genutzt werden könnte. Für diese sogenannte «Rekuperation» müsste jedoch gleichzeitig ein Bus an der Ladestation angeschlossen sein, der diese Energie aufnehmen kann. Die zusätzliche Ladestation könnte auch dazu beitragen, die Netzverstärkung zu verzögern oder punktuell zu vermeiden. Mit dem Projekt, das voraussichtlich bis zum Ende 2026 läuft, sollen diese Effekte erforscht, nachgewiesen und quantifiziert werden.
Sonnenschutzfolien an den Fenstern können im Sommer die Innentemperatur eines Trams spürbar senken. Dies spart Energie für die Kühlung. Aber wie gross ist der Spareffekt im Vergleich zu einem eventuellen Mehrverbrauch im Winter? Diese Frage wollen die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) in einem neuen Projekt beantworten.
Sonnenschutzfolien an den Fenstern von Bussen und Trams sind eine bekannte Massnahme – damit sinkt im Sommer die Innentemperatur um etwa 2 bis 3 Grad Celsius. Unklar ist der Effekt im Winter. «Wir wollen herausfinden, wie gross in einem Tram im Sommer die Energieeinsparung ist im Vergleich zum eventuellen Mehrverbrauch im Winter», sagt VBZ-Projektleiter Geoffrey Klein. Die Folien halten die Sonnenwärme auch in den kalten Monaten draussen, deshalb braucht es dann etwas mehr Energie für Heizung und Beleuchtung. Die Einsparungen und der Mehrverbrauch werden während einem Jahr gemessen.
Erwartet wird unter dem Strich eine Energieeinsparung von 4,0 MWh/Jahr pro Tram. Dies entspricht etwa dem jährlichen Stromverbrauch eines Einfamilienhauses. Das Projekt wird im Herbst 2025 beendet, die Erkenntnisse stehen anschliessend der Branche zur Verfügung.
Auf der steilen Strecke zwischen Spisertor und Trogen der Appenzeller Bahnen AG verkehren seit 2018 neue rekuperationsfähige Schienenfahrzeuge. Sie können beim Bremsen überschüssige Energie über die Fahrleitung und einen Wechselrichter ins öffentliche Stromnetz speisen. Gemäss den Annahmen im Schlussbericht des Projektes könnte die Investition innert elf Jahren amortisiert werden.
Seit gut vier Jahren speisen die Appenzeller Bahnen erfolgreich Bremsenergie zurück ins Stromnetz der St. Galler Stadtwerke. Dies wurde möglich dank rekuperationsfähigen Fahrzeugen kombiniert mit dem neuen Wechselrichter, der den bei Talfahrten erzeugten Gleichstrom von der Fahrleitung zurück ins öffentliche Wechselstromnetz der St. Galler Stadtwerke überführt. Der Wechselrichter wurde in die bestehende Gleichrichterstation Bavaria integriert.
Beim Projektstart wurde als Ziel eine Energierückgewinnung von 650 bis 750 MWh pro Jahr anvisiert. Dieses Ziel wurde am Anfang deutlich verfehlt, konnte aber mit Optimierungen an den Fahrzeugen und der Infrastruktur auf 484 MWh im Jahr 2023 erhöht werden – und damit auf rund 65 Prozent des ursprünglichen Betrags. Dies entspricht dem Stromverbrauch von rund 120 Einfamilienhäusern pro Jahr. Im Schlussbericht wird die Differenz zum ursprünglichen Projektziel mit verschiedenen Faktoren begründet: Weniger Gesamtenergieverbrauch, weniger Zugverkehr, dafür schwerere Fahrzeuge als in den ursprünglichen Energiestudien erwartet.
Unter dem Strich werten die Appenzeller Bahnen das Projekt als «gelungenes Beispiel für die erfolgreiche Rückgewinnung von Bremsenergie». Die Wirtschaftlichkeit der Investitionen hängt massgeblich vom Strompreis ab, den das Bahnunternehmen für das Einspeisen erhält. Mit der aktuellen Energievergütung wird die Amortisationszeit der Wechselrichteranlage auf ungefähr elf Jahre geschätzt.
Mit der Veröffentlichung der Energiekennzahlen 2022 für den öffentlichen Verkehr liegt erstmals eine Zeitreihe über drei Jahre vor.
Gegenüber den Vorjahren hat sich an den Verhältnissen nicht viel geändert. Die Bahn benötigt mit einem Anteil von 49 % immer noch am meisten Energie, gefolgt von den Autobussen mit 37 %. Bei den Treibhausgasemissionen entfällt mit 81.5 % nach wie vor der grösste Anteil auf die Autobusse. Die gesamten Daten sind auf der Website des BAV einsehbar.
September
Editorial
Die Dekarbonisierung des öffentlichen Verkehrs kommt gut voran. Auf der Seite der Busse ist die Technologie insbesondere zur Elektrifizierung weitgehend vorhanden und funktioniert gut. Für die Transportunternehmen ist dies jedoch eine wichtige Wende, welche Anlagen und Prozesse betrifft, die weit über die Fahrzeuge hinausgehen. Unser Programm ist auch dazu da, die Unternehmen bei diesem Übergang zu unterstützen. In der heutigen Ausgabe des Newsletters stellen wir Ihnen deshalb auch ein Projekt zur Optimierung der Ladeinfrastruktur bei Elektrobussen und ein Workshopangebot zu Fragen rund um die Elektrifizierung der Busse vor.
Auf der Seite des schienengebundenen Verkehrs können auch mit einem fast vollständig elektrifizierten Netz weitere Fortschritte erzielt werden. Projekte mit Baumaschinen und Rangierfahrzeugen legen davon Zeugnis ab.
Wir wünschen eine angenehme und spannende Lektüre!

© SBB Cargo AG
Die rund 1500 privaten Firmenanschlüsse ans Schienennetz gelten als Schnittstelle zum umweltschonenden Güterverkehr. Die Waren werden jedoch meistens von Rangierlokomotiven abgeholt und gebracht, die noch mit Diesel angetrieben werden. Mit einem neuen Projekt stellt «SBB Cargo» jetzt die Weichen für den Wechsel auf elektrische und mit Batterie betriebene Rangierlokomotiven.
Im Güterverkehr hat die Bahn dank dem hohen Elektrifizierungsgrad einen ökologischen Vorteil gegenüber dem Strassentransport. Ganz am Anfang und Ende der Strecke gibt es jedoch eine Lücke im ökologischen Angebot. Auf dem letzten Streckenabschnitt zu Firmen und Logistikzentren müssen oft auf den rund 1500 Anschlussgleisen Dieselloks eingesetzt werden. Dafür hat die SBB Cargo AG unter anderem 44 Diesel-Fahrzeuge des Typs Am 843 zur Verfügung. Diese sind aufgrund ihres anspruchsvollen Lastprofils und ihres bestehenden diesel-hydraulischen Antriebes schwierig zu elektrifizieren. In sechs Jahren sollen diese dennoch mit Lokomotiven ersetzt werden, die sowohl mit Strom aus einer Fahrleitung als auch autonom mit Batterie fahren können.
Die SBB hat sich mit der Ambition «Klimaneutrale SBB» das Ziel gesetzt, bis 2030 die Emissionen von Treibhausgasen gegenüber 2018 zu halbieren und bis 2040 weitgehend klimaneutral zu werden. Deshalb soll auch die Nahzustellung im Schienengüterverkehr emissionsfrei werden. Heute verursacht die Flotte der SBB-Rangierloks jährlich rund 10'000 Tonnen an Treibhausgasemissionen. Dies entspricht den jährlichen Treibhausgasemissionen von rund 770 Privatpersonen in der Schweiz. SBB Cargo will jetzt die Weichen für den Wechsel auf emissionsfreien Antrieb stellen, mit dem neu lancierten Projekt «Betriebserprobung vollelektrische Rangierlokomotiven». Der Titel deutet es an: Es werden nicht direkt neue Lokomotiven beschafft, vielmehr werden über die nächsten vier Jahre neue Fahrzeuge von verschiedenen Herstellern eingesetzt, um die technische und betriebliche Machbarkeit zu erproben.
Der Markt von batteriebetriebenen Rangierlokomotiven ist im Aufbau. Die SBB rechnen mit drei bis vier Fahrzeugen, die im Projektfenster bis Anfang 2028 getestet werden können. Bevor ein Kauf in Frage kommt, müssen die Fahrzeuge beweisen, dass sie den Anforderungen des Alltags gewachsen sind. Bei der Technik geht es darum, dass genügend Energie und Leistung bei unterschiedlichen Steigungen, Geschwindigkeiten oder Anhängelasten verfügbar ist. Und im Betrieb muss sich zeigen, ob die Lokomotiven typische Arbeitstage an den ausgewählten Standorten bewältigen können. Von der verfügbaren Kapazität der Batterie in verschiedenen Alltagssituationen hängt ab, ob, wo und wie lange sie zwischendurch nachgeladen werden müssen.
In Frauenfeld wird die primär im Gleisbau eingesetzte Diesellok Am 841 zu einem hybriden Fahrzeug mit Diesel- und Elektroantrieb umgebaut. Im Rahmen einer Besichtigung der Arbeitsgruppe «Nachhaltige Energie» des Verbandes öffentlicher Verkehr (VöV) wurden die Fortschritte beim Umbau vorgestellt.
Die Müller Technologie AG in Frauenfeld ist daran, fünf alte Dieselloks des Typs Am 841 zu modernen und umweltfreundlicheren Lokomotiven umzubauen. Rund zehn Personen der VöV-Arbeitsgruppe «Nachhaltige Energie» haben sich im Frühjahr 2024 über die Fortschritte informieren lassen. Der Anlass stiess auf grosses Interesse, es gab viele Fragen. Noch ist das erste Fahrzeug ein Prototyp. Deshalb muss beim Umbau einer alten Lokomotive mit Überraschungen gerechnet werden – vieles muss gemeinsam mit den Herstellern der Komponenten definiert und ausdiskutiert werden. Zudem können nicht alle Bauteile wie erhofft wiederverwendet werden. Zum Beispiel hatte es im Dieseltank mehr Rost als am Anfang erkennbar war. Die von Grund auf neu konzipierte Lokomotive Aeam 841 konnte in den Werkhallen der Müller Technologie AG bestaunt werden, wie die Fotos zeigen.
Mehr Informationen zum technischen Konzept des Umbaus finden sich im ESöV-Newsletter vom März 2022:
Nach einem erfolgreichen Praxistest mit einem «Strom-Bagger» in Minusio planen die SBB ein breit angelegtes Pilotprojekt mit elektrisch betriebenen Baumaschinen. Damit wollen die Bundesbahnen auch einen Stein in der ganzen Branche ins Rollen bringen. Denn: Es gibt immer mehr elektrisch betriebene Baumaschinen auf dem Markt, eingesetzt werden aber erst wenige.

© SBB
Baustellen sind ein lärmiger Ort. Bagger wühlen in der Erde, Drehbohrgeräte schrauben sich in die Tiefe, Radlader schaufeln Material hin und her. Die meisten dieser Maschinen werden mit Dieselmotoren angetrieben, die ebenfalls Lärm verursachen. Mit Strom betriebene Baumaschinen sind deshalb besonders erwünscht in bewohnten Gebieten, wo die Lärm- und Emissionsreduktion von hoher Bedeutung sind.
Für das neue SBB-Projekt «Elektrische Baumaschinen für ÖV-Baustellen» ist der Lärm nicht der wichtigste Treiber, aber ein willkommener Zusatzeffekt. Primärer Anlass für den geplanten Testbetrieb von fünf grösseren Elektro-Baumaschinen ist die Reduktion der CO2-Emissionen im Rahmen der Klimastrategie der SBB. Die SBB schliesst jährlich Tiefbau-Werkverträge im Wert von 1 Milliarde Franken ab. Auf den Baustellen ist das Thema Elektrifizierung aber bisher kaum angekommen.
Am Angebot an elektrisch betriebenen Baumaschinen mangelt es nicht. Marktbeobachter sind inzwischen der Meinung, dass sich mit den verfügbaren Maschinen und Geräten viele kleinere bis mittlere Standardbaustellen zu einem grossen Teil elektrisch bewältigen liessen. Bei der SBB ist vorgesehen, in Zukunft bei Ausschreibungen für Werkverträge auch Vorgaben an die Energieversorgung der eingesetzten Maschinen zu machen. Das revidierte Beschaffungsrecht gibt seit 2021 vor, dass öffentliche Mittel nicht nur nach wirtschaftlichen, sondern auch nach sozialen und ökologischen Kriterien vergeben werden müssen. Dies ist bei Baumaschinen aber erst möglich, wenn auf Basis von Messdaten, Erfahrungsberichten und realen Herausforderungen geklärt ist, wie ein Systemwechsel in eine Zukunft ohne fossile Treibstoffe machbar ist.
Auf einer SBB-Baustelle in Minusio wurde bereits ein 8,5-Tonnen-Elektrobagger während einem Jahr eingesetzt. Die Erfahrungen in diesem Pilotprojekt waren ermutigend. Der Elektro-Bagger wurden gut angenommen und es zeigte sich, dass die Technologie reif ist für den Einsatz ist. Die Sorge, dass die Batterien leer sind, bevor die Arbeit getan ist, erwies sich als unbegründet. Meistens wurde der Bagger am Ladestecker angeschlossen, bevor der Ladestand der Batterie unter 20 Prozent gefallen war. Es waren somit genügend Reserven vorhanden. Die 100-kWh-Batterie konnte über Mittag gut teilgeladen oder über Nacht voll nachgeladen werden. Zudem zeigten die Verbrauchsmessungen, dass die elektrisch betriebene Version gegenüber einem vergleichbaren thermischen Bagger pro Jahr rund vier Mal weniger Energie verbrauchte.
Mit dem neuen Projekt folgt der Praxistest mit grösseren Maschinen, die mehr Energie in kürzerer Zeit benötigen. Während je zehn Monaten werden Maschinentypen getestet, die auf Baustellen breit eingesetzt werden, eine Erprobung in der elektrifizierten Version im Alltag aber noch aussteht. Geplant sind je ein Bagger 23t, ein Drehbohrgerät, ein Generator, ein Mobilbagger 15t sowie ein Radlader 6t. Die definitive Auswahl der Maschinen wird nach Verfügbarkeit und Offerten während des Projektes definiert. Die Erfahrungen werden am Ende gemeinsam mit Planenden, Projektleitenden und Baufirmen in einem Leitfaden «Elektrische Baumaschinen auf Baustellen des öffentlichen Verkehrs» zusammengefasst und publiziert. Ziel ist es auch, in der Baubranche Vorbehalte gegen Elektromaschinen zu widerlegen und einen Stein ins Rollen zu bringen.
Die Stadt Chur will ihren Busbetrieb schrittweise von «nur fossil» auf «Netto-Null» umstellen. Es ist ein Weg, auf dem noch viele Fragen zu klären sind. Elektrobusse und Ladeinfrastruktur sollen deshalb in Etappen beschafft werden. Die erste Praxiserfahrung gibt es Ende 2026 auf einer Tangentiallinie.
Wer in Chur mit dem Bus ins Zentrum will, muss sich nicht gross orientieren. Auf allen Linien kommt man irgendwann am Hauptbahnhof vorbei. Eine zusätzliche tangentiale Verbindung vom Kantonsspital ins Sport- und Einkaufsquartier Chur West ist im Bündner Hauptort schon lange ein Bedürfnis. Die Kosten für bauliche Anpassungen und Betrieb verzögerten jedoch die Einführung. Jetzt aber soll die Tangentiallinie kommen – mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2026 und mit den ersten zwei Elektrobussen in der Stadt Chur. Im April 2023 verabschiedete der Stadtrat den «Masterplan Energie und Klima Stadt Chur». Dieser enthält ein klares Ziel: «Die Bus und Service AG betreibt den Busbetrieb (Churer Streckennetz) im Jahr 2040 CO2-neutral und erneuerbar.» Gemäss diesem Ziel sollen «spätestens per 2028 nur noch Busse mit erneuerbaren Antriebssystemen beschafft werden». Dies bedeutet auch die «Bereitstellung elektrischer Energie aus erneuerbaren Quellen und entsprechender Ladeinfrastruktur».
Aktuell hat die «Bus und Service AG» (Chur Bus) 32 Standard- und Gelenkbusse im Einsatz, davon sind 14 Hybrid (mit Elektro- und Verbrennungsantrieb), die übrigen mit reinem Dieselantrieb. Die Umstellung ist eine grosse Herausforderung. So kann das Laden aller Busse im Depot zu Versorgungsspitzen und hoher Wärmeabstrahlung bei der Ladeinfrastruktur führen. Zudem haben die Busse auf den langen Linien einen hohen Energiebedarf und brauchen deshalb Batterien mit grosser Kapazität oder eine Zwischenladung. Obwohl vor allem die einmalige «Depotladung» in der Nacht im Vordergrund steht, will sich die Projektleitung möglichen Entwicklungen nicht verschliessen. Deshalb wird auch ein dynamisches Laden während der Fahrt geprüft. Zudem muss sichergestellt sein, dass bei Netzunterbrüchen eine Notstromversorgung zur Verfügung steht.
Bei der Umstellung auf erneuerbaren Antrieb will Chur Bus die offenen Fragen schritt- und phasenweise beantworten. Die Busbetriebe wollen die raschen technischen Fortschritte bei Bussen, Batterien oder Infrastrukturen aufmerksam verfolgen und nur Produkte kaufen, die verlässlich funktionieren. Die neue Tangentialline auf Ende 2026 ist ein erstes Ziel. Bis spätestens im Sommer 2025 müssen deshalb alle Konzepte und Strategien für die Beschaffung oder für das Aufladen der Batterien erarbeitet werden. Das Projekt sieht dabei eine modulare und skalierbare Ladeinfrastruktur im Hinblick auf eine phasenweise Beschaffung der Elektrobusse vor. Im Rahmen des ESöV 2050 Programmes wird die Ausarbeitung der Konzepte sowie die Erstellung eines Leitfadens zur Auslegung und Integration der Ladeinfrastruktur unterstützt.
Einen Beitrag zur Energieeffizienz plant Chur Bus mit der Ladeinfrastruktur. Der Energiebedarf für das Laden der Batterien beträgt ungefähr 9'300 kWh. Im Traforaum entstehen während eines Ladevorgangs Energieverluste in der Grössenordnung von 550 kWh pro Tag. Ob diese Abwärme dereinst für das Busdepot oder andere Räumlichkeiten genutzt werden kann, soll das Projekt zeigen. Ausserdem soll eine PV-Anlage mit einer Speicherlösung den Stromverbrauch reduzieren und für eine gewisse Autarkie sorgen.
Noch dominieren Dieselbusse den öffentlichen Verkehr. Doch der Elektrobus holt auf, denn immer mehr neue beschaffte Fahrzeuge haben einen Elektroantrieb. Nur: Wie und in welchem Zeitraum lässt sich die bestehende Dieselbusflotte vollständig auf fossilfreie Antriebe umstellen? Antworten gibt die Strategie des Verkehrsverbunds Luzern.
Bereits nach fünf Jahren hat der Verkehrsverbund Luzern (VVL) seine Strategie für einen fossilfreien öffentlichen Verkehr überprüft. Dies, weil die Innovation und Entwicklung alternativer Antriebstechnologien zu Dieselbussen sehr dynamisch ist. Es sollte geklärt werden, auf welchem Umsetzungspfad die Vision einer fossilfreien Busflotte bis zum Jahr 2040 erreicht werden kann. Die Strategie zeigt: Nach heutigem Stand der Dinge fährt der letzte öffentlich bestellte Dieselbus im Jahr 2038 endgültig ins Depot.
Die Strategie fokussiert auf den VVL, enthält aber in der Einleitung eine gute Übersicht über die Entwicklungen in Europa und für die ganze Schweiz. Bei den Neuzulassungen von Linienbussen ist der Anteil der Elektrofahrzeuge in der Schweiz im Jahr 2022 stark angestiegen und machte bereits 36 Prozent aus. Die Schweiz befindet sich damit im oberen Mittelfeld in Europa. Allerdings ist der Bestand von Elektrobussen an der Schweizer Gesamtflotte mit drei Prozent noch immer gering. Im März 2023 waren 9800 Busse registriert. Davon sind knapp 600 Busse voll elektrisch angetrieben. Seit einiger Zeit setzen die Transportunternehmen tendenziell vermehrt auf Depotlader. Verantwortlich dafür ist der technologische Fortschritt bei den Batterien, der zu einer deutlichen Steigerung der Reichweiten pro Ladung führt.
Der öffentliche Bus der Zukunft fährt mit Strom, einige allenfalls auch mit Wasserstoff. Transportunternehmen in der ganzen Schweiz sind mitten in einer Beschaffung oder bereiten diese vor. Damit das bereits verfügbare Wissen geteilt wird, unterstützt das Programm ESöV 2050 dezentrale Workshops für den Erfahrungsaustausch.
Für Busbesteller stellen sich bei der Umstellung auf Elektrobusse viele neue Fragen: Soll die Batterie gekauft oder geleast werden? Ist für die Batterie ein Vertrag über den ganzen Lebenszyklus sinnvoll (LCC-Vertrag). Welche finanzielle Auswirkung hat die Umstellung? Welche technologischen Entwicklungen sind zu erwarten und wann können auch die schwierigsten Linien elektrifiziert werden? Wie kann die Kommunikation zwischen Betriebsmanagement, Ladeinfrastruktur und Fahrzeuge gewährleisten werden? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, unterstützt das Programm ESöV 2050 ein Angebot des Beratungs- und Ingenieurunternehmens EBP Schweiz, das bis Mitte 2025 eine Workshop-Reihe in allen drei Sprachregionen der Schweiz organisiert.
In Zusammenarbeit mit grösseren Transportunternehmen, die bereits Erfahrungen mit der Beschaffung von Elektrobussen haben, sowie den kantonalen Ämtern des öffentlichen Verkehrs werden die wichtigsten Themen vorgestellt und diskutiert. Dazu gehören der Stand der Technik, bisherige Erfahrungen, mögliche Bestellstrategien, häufige Fehlerquellen bei den Ausschreibungen oder beschaffungsrechtliche Fragen. Die Workshops dauern jeweils vier oder sechs Stunden. Die Teilnahme an den Workshops ist kostenlos.
Weitere Informationen und einen Link für die Anmeldung finden Sie auf der folgenden Webseite:
März
Editorial
Ein gutes Jahr ist es her, dass ich die Programmleitung ESöV 2050 ad interim übernommen habe. Die neue Aufgabe hat meinen Arbeitsalltag recht auf den Kopf gestellt – obwohl ich bereits die Jahre davor für das Programm gearbeitet habe. Vor allem aber ist mir noch klarer geworden, wie viele kompetente und äussert engagierte Menschen die Innovationen für Energieeffizienz im öV vorantreiben. Die Projekte, die wir in diesem Newsletter vorstellen, sind ein gutes Beispiel dafür. Die Begegnungen mit diesen Menschen waren eine schöne Erfahrung, und sie ermöglicht es mir, die Programmleitung nun mit einem guten Gefühl und Schritt für Schritt an Stany Rochat zu übergeben. Herzlich willkommen und weiterhin einen guten Start, Stany!
Stephan Husen, Programmleiter ESöV 2050 a.i.
(Interview und Bild von Stany am Ende dieses Newsletters)

© tl
Der Fahrgastraum der Metro 1 in Lausanne wird nur noch bis maximal 15 Grad erwärmt – früher waren es 18 Grad. Eine einfache Massnahme, die von den Reisenden kaum bemerkt wird, dem städtischen Transportunternehmen aber viel Energie spart.
Bei Studierenden in Lausanne ist die Metrolinie M1 sehr beliebt, weil sie das Ausgeh- und Einkaufsviertel Flon mit dem Bahnhof Renens verbindet – und dabei über die Eidgenössische Technische Hochschule (EPFL) und die Universität Lausanne führt. Bei Trolleybussen hatte die städtische «Transports publics de la région lausannoise» (tl) die Energieeffizienz bereits verbessert, deshalb wurde ein analoges Projekt gestartet für die Linie M1. Um eine transparente Datenbasis zu haben, wurde der Energieverbrauch ein Jahr lang im Detail gemessen – für den Antrieb, für Heizung-Lüftung-Klima (HLK) oder für unterstützende Systeme wie Batterien, Pumpen oder Kompressoren.
Die Zahlen zeigten, dass für den Antrieb 73,7% der Energie verbraucht wird. Sie zeigten aber auch, dass der Bereich HLK 14,9% der Energie braucht, davon 97% für die Heizung. Und: Im Schlummerbetrieb, wenn ausserhalb der Fahrzeiten alle Systeme im Zug auf eine minimale Leistung reduziert sind, wurde fast so viel Heizenergie verbraucht wie im Normalbetreib. Vor diesem Hintergrund wurde beschlossen, im zweiten Messjahr 2021 die Temperatur im Fahrgastraum von 18°C auf 15°C zu senken. Noch mehr gesenkt wurde die Temperatur im Schlummerbetrieb, und zwar auf 8°C im Fahrgastraum und 17°C im Führerstand. Allein diese einfachen Massnahmen führten dazu, dass der Anteil von Heizung-Lüftung-Klima am Energieverbrauch des Zuges im Vergleich zum ersten Jahr von 14,9 auf 6,5% mehr als halbiert werden konnte. Damit reduzierte sich der gesamte Nettoenergieverbrauch des Fahrzeugs um 8,4%. Die tieferen Temperaturen wurden von den Gästen gut akzeptiert – Reklamationen gab es jedenfalls keine.
Erhofft hatten sich die Projektverantwortlichen der tl einen Spareffekt von 10'000 kWh pro Fahrzeug, realisiert werden konnten mit 24'206 kWh mehr als doppelt so viel. Inzwischen wurden die Massnahmen bei allen 22 Fahrzeugen der Linie M1 umgesetzt. Die tl rechnen mit jährlichen Einsparungen von 484 MWh, dies entspricht dem Stromverbrauch von fast 120 Haushalten (4 Personen, Einfamilienhaus).
Die bekannte rote Lokomotive Re 460 der SBB ist eine kräftige Maschine. Aber im Betrieb braucht es nicht immer die ganze Zugkraft und ein Teil der Motoren kann abgestellt werden. Das spart Strom, ist aber eine zusätzliche Belastung für die Getriebe.
Die Steuerung ist vorbereitet: Für die 119 Lokomotiven vom Typ Re 460 der SBB wurde eine Software entwickelt, die ein Abschalten eines Drehgestells ermöglicht, wenn bei einer Fahrt nicht die ganze Zugkraft notwendig ist. Eingeführt und in einem Betriebsversuch getestet wurde dieser «Teillastbetrieb» aber erst bei einigen Lokomotiven. Erste Auswertungen zeigen, dass der reduzierte Betrieb den Energieverbrauch der ganzen Flotte um 1,5% (oder 5 GWh pro Jahr) reduzieren kann. Dies entspricht dem jährlichen Stromverbrauch von 1200 Haushaltungen.
Eine Einführung bei allen Re 460 Lokomotiven muss jedoch sorgfältig vorbereitet werden. Beim Teillastbetrieb werden einzelne Antriebsstränge ausgeschaltet, und es muss sichergestellt werden, dass die Getriebelager im lastfreien Betrieb keinen Schaden nehmen. Deshalb wurden ab 2019 erste Fahrzeuge mit dem Teillastbetrieb eingesetzt und permanent überwacht. Anschliessend wurde der Zustand der kritischen Zwischenlager in regelmässigen Abständen untersucht. Nach 250'000 Kilometern, also einem Viertel der Einsatzzeit der Lager, wurden zwar Verschleissspuren auf den Lagern festgestellt, die auf den lastfreien Betrieb zurückzuführen sind. Diese waren aber so gering, dass seit dem Frühjahr 2021 weitere Fahrzeuge in den Probebetrieb genommen wurden - dies auch, um eine breitere Datenbasis zu erhalten. Mit Blick auf eine mögliche Strommangellage wurde der Teillastbetrieb im Winter 2022/23 vorübergehend sogar bei 30 Prozent der Lokomotiven aktiviert.
Die Stromersparnis beim Teillastbetrieb ergibt sich, weil sich durch das Abschalten der Motoren Umrichter- und Antriebsverluste reduzieren. Gleichzeitig können die aktiven Motoren und Umrichter in einem besseren Wirkungsgradbereich betrieben werden.
Der Probebetrieb ist inzwischen nahezu abgeschlossen. Erste Getriebelager sind am Ende ihrer normalen Einsatzzeit, werden ausgebaut und von Experten beurteilt. Aktuell werden die Berichte der Analysen erstellt und die Resultate ausgewertet. Wenn der zusätzliche Verschleiss der Lager im Getriebe durch den Teillastbetrieb die normale Einsatzdauer und die Laufleistung nicht beeinträchtigt, steht einer Einführung für die ganze Flotte der Re 460 nichts im Weg.
Auf dem Vierwaldstättersee könnte mit der MS Saphir in einigen Jahren erstmals in der Schweiz ein grosses Fahrgastschiff im dichten Taktfahrplan ohne Ausstoss von Schadstoffen eingesetzt werden. Im Moment werden in einer Studie die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit des Umbaus geprüft.
Als «neues Juwel auf dem Vierwaldstättersee» begrüsste die Luzerner Regionalpresse die MS Saphir bei der Betriebsaufnahme vor 12 Jahren. Gelobt wurde unter anderem das moderne Cabriolet-Dach, das «je nach Witterung geöffnet oder geschlossen werden kann». Den Technikern fiel damals eher das innovative Energiesystem im Rumpf auf: Ein kombinierter Antrieb mit Diesel- und Elektromotoren, der den Treibstoffverbrauch im Vergleich zu einem reinen Dieselantrieb um rund einen Fünftel senkt.
Jetzt planen die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) und ihr Schwesterunternehmen Shiptec mit der MS Saphir den nächsten Innovationsschritt: die Umstellung der Energieversorgung auf eine Brennstoffzelle, unterstützt durch eine Batterie für kurzfristig notwendige Spitzenleistungen des Motors. «Zero-Emission-Saphir» heisst das Projekt. Die Machbarkeit eines emissionsfreien Antriebs in einem dichten Fahrplan wurde bereits im Jahr 2019 im Rahmen des Projektes «Helios» untersucht. Auf der Basis der damaligen Erkenntnisse wird momentan der Umbau des Schiffes geplant und die Wirtschaftlichkeit des Betriebs untersucht. Der für den Antrieb notwendige Wasserstoff soll «grün» sein, also mit Wasserkraft aus dem Reusstal produziert werden.
Die Investitionen werden auf rund 5,4 Millionen Franken geschätzt. Als Gegenwert versprechen die Initianten «einen absolut schadstofffreien Betrieb eines Personenschiffs auf einem Schweizer Binnensee». Noch ist es aber nicht so weit. Im laufenden Jahr werden in den Phasen «Initial-Design» und «Basic-Design» zuerst alle Grundlagen für den Umbau des Schiffes geklärt sowie anschliessend die konkrete Umsetzung geplant. Dazu gehören der Vergleich der CO2-Emissionen des heutigen und zukünftigen Antriebs und der Vergleich der Totalkosten beider Varianten. Ein Zwischenbericht, der Ende Jahr vorliegen soll, dient als Grundlage für den Entscheid, ob der bis Ende 2026 geplante Umbau des Schiffes weiterhin vom Programm ESöV unterstützt wird.
In Bezug auf mögliche CO2-Einsparungen blickt der Projektplan von «Zero-Emission-Saphir» über den Horizont dieses einen Schiffes hinaus. Eine emissionsfreie MS Saphir spart 75'000 Liter Diesel pro Jahr. Dies entspricht dem jährlichen Treibhaus- Ausstoss von 15 Personen in der Schweiz (CO2-Äquivalent). Würden dereinst alle 150 Kursschiffe auf den Schweizer-Seen schadstofffrei fahren, könnten die vom Personenverkehr in der Schweiz verursachten Treibhausemmissionen um 7 Prozent reduziert werden. Und die Passagiere an Bord müssten erst noch weniger Lärm und weniger Vibrationen der Dieselmotoren erdulden.
Täglich bis zu 350 Kilometer fährt heute ein Gelenkbus auf dem Netz des Busbetriebs Solothurn und Umgebung AG (BSU). Ohne Zwischenladungen erreichen elektrisch betriebene Gelenkbusse noch keine solchen Reichweiten. Zusammen mit dem Bellacher Busbauer «Carrosserie HESS AG» will der BSU jetzt herausfinden, wie die 18 Meter langen Busse energieoptimiert werden können. Das Resultat wird ein wichtiger Faktor sein beim geplanten Vollersatz aller Diesel-Gelenkbusse.
Vor bald 100 Jahren brachten die ersten Busse der Gesellschaft «Autokurs Solothurn-Wasseramt» Fahrgäste von Solothurn ins 10 Kilometer entfernte Recherswil. Heute heisst die Organisation «Busbetrieb Solothurn und Umgebung AG» (BSU) und ist verantwortlich für 12 Linien auf einem Streckennetz von 160 Kilometern. 47 Linienbusse fahren jährlich über 3 Millionen Kilometer und transportieren dabei mehr als 6 Millionen Menschen. Die erste Linie nach Recherswil ist die Linie 1 geblieben.
Auf dieser Linie 1 war während vielen Jahren der dieselbetriebene Gelenkbus Nr. 50 im Einsatz. Inzwischen hat das Fahrzeug die maximale Einsatzdauer erreicht und wurde ausser Betrieb genommen. Gemäss der Flottenstrategie des BSU werden die Gelenkbusse erst ab 2028 durch Elektrobusse ersetzt. Für das Fahrzeug Nr. 50 war als Ersatz ein Dieselhybridfahrzeug vorgesehen. Die Gelenkbusse legen auf dem BSU-Netz täglich bis zu 350 Kilometer zurück und sind das Rückgrat des öffentlichen Strassenverkehrs in der Region Solothurn. Vollelektrische Modelle haben beim heutigen Stand der Technik noch eine unzureichende Reichweite für den Einsatz auf den BSU-Linien.
Die Simulation im Projekt «Swiss eBus Plus» hat zwar bereits gezeigt, dass Elektrobusse dank neuen Fahrzeugkonzepten mehr als 250 Kilometer unterwegs sein können. Diese Erkenntnisse wollen der BSU und Bellacher Bushersteller Hess jetzt auf die langen Gelenkbusse übertragen. Diese stellen mit dem grossen Fahrgastraum, den vielen Türen und dem kaum isolierten Gelenkbalg zusätzliche Anforderungen an einen energieeffizienten Betrieb. In den kalten Wintermonaten wird bis zu 50 Prozent der Gesamtenergie fürs Heizen verwendet. Die Minimierung des Energieverbrauchs ist deshalb ein wesentlicher Schlüssel für die Alltagstauglichkeit von batteriebetriebenen Grossfahrzeugen.
Welche Reichweite ohne Nachladen möglich ist, wissen die Projektverantwortlichen noch nicht. Die Massnahmen zur Optimierung des Energieverbrauchs müssen von der Firma noch entwickelt, verfeinert und getestet werden. Ziel ist einerseits eine optimale Energieversorgung, andererseits soll der Nebenverbrauch des Fahrzeugs massiv reduziert werden. Untersucht oder umgesetzt werden zum Beispiel die folgenden Massnahmen:
- Neuartige Batterien mit maximaler Energiedichte;
- Optimierte Isolation des Wagenkastens (inkl. Verglasung);
- Isolation für den Gelenkbalg;
- Nutzen der Abwärme der Traktionsmotoren;
- Türluftschleier bei den Ein- und Ausgängen;
- Intelligentes Temperatur-Managementsystem.
Der Elektrobus ist als Prototyp im Bau und soll im Frühsommer bereit sein für erste Tests. Der Einsatz auf den BSU-Linien 1 und 4 ist ab November 2024 geplant. Das Fahrzeug wird anschliessend im Betrieb laufend optimiert und weiterentwickelt.
Der BSU verfolgt jedoch bereits ein langfristiges Ziel: Zusammen mit allen anderen fossil betriebenen Bussen sollen auch alle 19 Gelenkbusse schrittweise ersetzt werden. Mit dem Ziel, die ganze Busflotte bis in spätestens 12 Jahren auf Batteriebetrieb umstellen zu können – dank der grösseren Reichweite wenn möglich ohne Mehrbedarf an Fahrzeugen.
Stany Rochat hat im Januar dieses Jahres seine Stelle als Leiter des Programms ESöV 2050 angetreten. Er ist ausgebildeter Elektroingenieur und hat seit seinem Abschluss 2007 in einem privaten Büro an Projekten zur Stromversorgung im öffentlichen Verkehr gearbeitet. Er stellt sich vor und erklärt, was ihn an diesem Programm motiviert.

Was hat Dich daran gereizt, Dich für die Stelle als Programmleiter zu bewerben?
Ich arbeite seit über 15 Jahren im Bereich des öffentlichen Verkehrs. Meine Ausbildung und eine spannende Berufserfahrung haben dazu beigetragen, dass ich eine gewisse Faszination entwickelt habe für alles, was sich um die Elektromobilität dreht. Die Dutzenden von Systemen zur Versorgung mit Traktionsenergie, die ich dimensioniert habe, haben mir auch gezeigt, welche immensen Energiemengen dabei im Spiel sind. Daher sah ich in diesem Programm eine massgeschneiderte Gelegenheit, meinen Beitrag dazu zu leisten, das System nachhaltiger und effizienter zu gestalten, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen, die die Nutzer unserer öffentlichen Verkehrsmittel erwarten.
Welche Schwerpunkte möchtest Du im Programm setzen?
Ich möchte auf der hervorragenden Arbeit aufbauen, die meine Vorgänger geleistet haben, und ich möchte noch weiter gehen, weil wir an Erfahrung gewonnen haben, weil sich die Technologien weiterentwickeln und weil Stagnation nicht gut ist. Mein Ziel: Die Akteure des öffentlichen Verkehrs sollen im Programm ESöV 2050 einen zuverlässigen und effizienten Partner finden, der ihnen zur Seite steht, um mit Innovationen einen Schritt in die Zukunft des Verkehrs in unserem Land zu machen. Insbesondere möchte ich die Sichtbarkeit des Programms erhöhen, die Wirkung der Investitionen über die ersten zehn Jahre überprüfen und die Instrumente für die laufende Evaluation verfeinern.
Welche Erfahrungen aus früheren Tätigkeiten bringst Du dafür mit?
Ein breites Wissen über die Welt des öffentlichen Verkehrs, die Abläufe, denen sie folgt und die Organisationen, die sie vorantreiben. Ein großes Kontaktnetz im ganzen Land und über die Sprachgrenzen hinweg sowie die Fähigkeit, die Unternehmen in ihrer betrieblichen Realität zu erreichen und sie davon zu überzeugen, den nächsten Schritt zu tun. Aber ich habe auch großen Respekt vor der Komplexität der Beziehungen zwischen den Beteiligten: der Politik, den öffentlichen und privaten Unternehmen und den Reisenden.
Was tust Du gerne, wenn Du gerade nicht an der Arbeit bist?
Ich verbringe gerne Zeit mit meiner Familie, oft in der Natur oder auch in öffentlichen Verkehrsmitteln - um die vorbeiziehende Landschaft zu bewundern oder um über all die Dinge zu staunen, die doch so gut funktionieren und nicht immer gleich ins Auge springen.