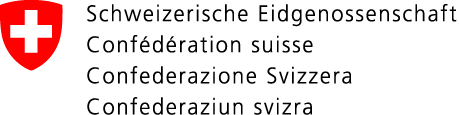Editorial
An einem heissen Sommertag in einem nicht klimatisierten Fahrzeug zu sitzen, kann sich heute kaum mehr jemand vorstellen. Und doch: Vor dreissig Jahren war das im Bahnverkehr die Normalität, als die Flotte der SBB mehrheitlich aus den sogenannten Einheitswagen I und II bestand. Zur Kühlung gab es damals nur eine Möglichkeit: Die Fenster herunterzulassen und den Fahrtwind zu geniessen. Im Winter war es nicht viel besser: Die Wände fühlten sich wegen der schlechten Dämmung kühl an, die Fenster waren undicht, und die Widerstandsheizungen unter den Sitzen wärmten vor allem die Füsse.
Es ist eindeutig: die Fahrzeuge im öV sind behaglicher geworden. Möglich wurde dies durch eine bessere Dämmung sowie durch ausgeklügelte Heizungs-, Kühlungs- und Lüftungssysteme. Die grosse Herausforderung ist heute, die Fahrzeuge jederzeit behaglich zu halten, ohne aber dabei Energie zu verschwenden. Eine einfache Massnahme wäre, im Winter die Raumtemperatur zu senken. Allerdings darf dies nicht dazu führen, dass sich die Fahrgäste weniger behaglich fühlen. Zwei aktuelle Projekte verschiedener Bahnunternehmen und der Hochschule Luzern (HSLU) aus dem Programm ESöV 2050 haben nun gezeigt, dass die Mehrheit der Fahrgäste bei einer Absenkung der Raumtemperatur um bis zu 3 Grad die Fahrzeuge nicht als zu kühl empfindet. Mit einer generellen Absenkung in diesem Ausmass liessen sich bis zu 38 GWh elektrische Energie pro Jahr einsparen, was dem Energieverbrauch von 9'500 typischen Einfamilienhäusern mit vier Personen entspricht. Der Verband öffentlicher Verkehr empfiehlt den Transportunternehmen nun, eine dauerhafte Absenkung der Raumtemperatur zu prüfen.